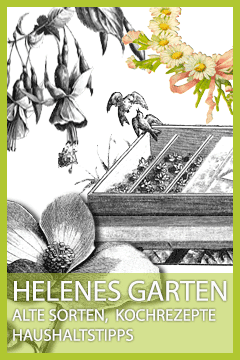Die Geschichte der Landwirtschaft in Schlesien
Zum Durchsuchen dieser Seite drücken Sie bitte STRG+F, bitte beachten
Hier gehts zur Zeitachse der Geschichte Schlesiens
Die Landwirtschaft bildet die Grundlage aller volkswirtschaftlichen und damit auch gesellschaftlichen Entwicklung; denn sie versorgt alle Schichten der Bevölkerung mit den notwendigen Lebsensbedürfnissen, liefert der Industrie den Arbeitsstoff und beide vereint dem Handel die Roh- und Kunstprodukte. Die Träger der Landwirtschaft sind die Grundbesitzer, insbesondere der Bauernstand. Wie derselbe sich entwickelte, darüber dürften die genaueren Daten schwer aufauszufinden sein. Jedenfalls war schon zur grauen Vorzeit mit diesem Stande die Untertänigkeit verknüpft; denn der Besitzer eines größeren Gutes benötigte in der Regel fremde Hilfe, um sein Gut nutzbringend zu machen. Diese Hilfe brachten ihm die Kriege der Völker untereinander. Die Überwundenen wurden nach altem Brauche vom Sieger zu Sklaven gemacht und als solche zu allen Arbeiten, insbesondere auch zur Bestellung der Felder verwendet. Ähnliches geschah zu Zeiten auch in Staaten, wo Gesetzlosigkeit vorherrschte und der Schwache dem Stärkeren und dessen Übergriffen gegenüber gesetzlich nicht geschützt war. Der schutzlose Bauer geriet dadurch in immer größere Abhängigkeit vom Grundherrn und wurde von diesem gezwungen, oft durch erpreßte Verträge, immer mehr Dienste zu leisten und sogar auf Verpflichtungen einzugehen, die selbst seine persönliche Freiheit nach und nach untergruben. Er wurde damit in jenes Verhältnis zum Gutsherrn gestellt, das man mit dem Ausdrucke Leibeigenschaft bezeichnet. Die Leibeigenen waren schon von Geburt aus in einer unauflösbaren Abhängigkeit vom Leibherrn. Sie durften ohne Bewilligung ihrer Herrschaft sich nicht verehelichen, kein Handwerk lernen, sich nicht von der Herrschaft wegbewegen oder sogar hinwegziehen. Es war rein von der Willkür des Gutsherrn abhängig, die Einwilligung zu verweigern oder sie an beliebige Bedingungen (Lossagungsgeld u.s.w.) zu knüpfen. Der Leibeigene war nicht Besitzer, sondern nur Wirtschafter von dem Grunde, den erbebaute und durfte nicht einmal über sein Privatvermögen frei verfügen. Auch stand in manchen Fällen dem Leibherrn sogar das Züchtigungsrecht an seinen Untertanen zu, das nur zu oft in unmenschlicher Weise ausgeübt wurde. Wir wollen nun im Folgenden versuchen, historisch darzulegen, auf welche Weise der deutsche Bauernstand des Gesenkes allmählich bis zur Leibeigenschaft herabgedrückt und wie er wieder von dieser und der Robot befreit wurde. Als die deutschen Bauern im 12. und 13. Jahrhunderte von den böhmischen Fürsten, Prälaten und weltlichen Feudalherrn herbeigerufen wurden, um die Wälder des unproduktiven Gesenkes auszuroden und in fruchtbaren Ackerboden umzugestalten, kurz, deutsche Dörfer anzulegen, um damit deren Besitz ertragreicher zu machen, gab es noch keine Robot, sondern die Ansiedler hatten vielmehr für den ausgerodeten Grund 10 bis 20 Jahre gar keine Abgaben zu entrichten. Erst nach Ablauf dieser bedungenen Zeit hatten sie der Gutsherrschaft für jede Hufe, die dem Ansiedler zur Bewirtschaftung zugewiesen worden
war, den sogenannten Erbzins (gewöhnlich eine Mark Silber), auch wohl den bischöflichen Zehent zu entrichten und zur Erhaltung der Brücken und Wege beizutragen. Von einer Robot ist in den vorhandenen Besiedlungsurkunden aus dem 12. und 13. Jahrhundert nirgends die Rede; die Bauern des Gesenkes haben demnach in jener frühen Zeit weder einem Grafen noch einem andern Feudalherrn roboten müssen. Sie waren emphyteutische (erbliche Pächter) Besitzer eines von ihnen urbar gemachten Grundstückes, für das sie dem Landesfürsten die Grundsteuer und dem Grundherrn den üblichen jährlichen Zins (canon) zu entrichten hatten.
Die Robot kam erst später und zwar zum erstenmale anfangs des 14. Jahrhunderts bei der Gründung des Dorfes Steinbach, jetzt Kunzendorf, nördlich von Fulnek, vor. Wir lesen bei Biermann „Geschichte der Herzogtümer Troppau und Jägerndorf“ S. 83, daß ein Theodorich (Dietrich) von Füllstein, Kanonikus von Olmütz, um die Einkünfte seines Besitzes zu vergrößern, den 26. Dezember 1300 seinem getreuen Kunzo (Ehunrad) am Mittellaufe des Steinbaches einen Wald zum Ausroden und zur Anlage eines Dorfes, das den Namen Steinbach führen sollte, gegeben hatte. Für seine Mühewaltung erhielt Ehunrad, die Schultisei, einen zinsfreien Lahn (Hufe), den er mit einem Pfluge bearbeiten solle, jeden siebenten Lahn, den er verzinsen sollte und eine Mühle mit zwei Rädern. Für jedes Rad, das er mehr errichtet, zinst er jährlich ein Vierding reines Silber. Ferner erteilte der Kanonikus ihm die Befugnis, eine Schenke zu errichten, eine Brot- und Fleischbank, einen Schuster, Schneider und Schmied zu halten und er erhielt schließlich noch den dritten Pfennig der Gerichtsgefälle zugesprochen. Was die Ansiedler selbst betrifft, so wird ihnen in der Lokationsurkunde zwanzigjährige Zinsfreiheit zugesichert, nach deren Ablauf für jeden Lahn jährlich ein Vierding Silber zu Walburgis und Martini zu zinsen ist. Zum Schlusse aber werden die Bauern des Dorfes noch verpflichtet, jährlich viermal Ackerrobot (inyizte in zrntutz) zu leisten. Dr. Karl Berger bemerkt hiezu auf S. 18 in seiner verdienstvollen Abhandlung ,,Die Kolonisation der deutschen Dörfer Nordmährens« in der Zeitschrift des deutschen Vereines für Geschichte Mährens und Schlesiens vom Jahre 1905: ,,Wir hören hier das erstemal in einer Lokationsurkunde von Feldrobot. Von bescheidenen Anfängen, wie hier, sind diese Robotverpflichtungen im Laufe der Zeit zur drückendsten Last angewachsen.« Aus dem Voranstehenden geht hervor, daß urkundlich nachweisbar die erste Feldrobot im Gebiete der Troppauer Provinz ein Prälat des Olmützer Domkapitels unter der Regierung des schlaffen Königs Wenzel ll. und zur Zeit Nikolaus l. verlangte, als letzterer sich um sein
Land wenig zu kümmern vermochte, da er auswärts desselben in Krakau wohnte und als Hauptmann des Reiches Polen vielfach in Anspruch genommen war. Das Beispiel des Domherrn Dietrich von Füllstein fand bei dem maßlos anspruchsvollen Adel nur zu bald und gern eifrige Nachahmung. Man gewöhnte sich allmählich daran, die deutschen Ansiedler wie die einheimischen slawischen Hörigen zu behandeln und ihnen immer größere Lasten entgegen den Abmachungen aufzubürden. Wichtig für uns ist auch die Urkunde, nach welcher der Olmützer Bischof Johann M1. im Jahre 1345 das öde Dorf Schönhof dem Richter
Jaklinus von Eurowitz zur Wiederbesiedelung und Anpflanzung übergibt. Es heißt darin: ,,Allen Leuten, die dieses Dorf wieder besiedeln wollen, gibt er eine vollständige Steuerfreiheit auf nur mehr fünf Jahre, nach deren Ablauf jeder Lahn 31sz Bierding Prager Groschen in zwei Terminen an das Nonnenkloster Pustomek zinsen muß. „Ferner müssen die Ansiedler Zehent und ent-sprechende Robot (robote18** Robot ist entlehnt aus dem Slawischen; robots-. d. i. (Knechts-)Arbeit,Fronarbeit, tod = Knecht, Knabe.) leisten. Hier ist das Wort Robot direkt und zum erstenmale genannt und auffälligerweise wieder in einer bischöflichen Lokationsurkunde. Jaklin erhält für seine Mühe als Lokator einen Freilahn, ist befreit von Zins, Steuer, Robot und Gebereien und bekommt den dritten Denar. Aus besonderer Gunst wird ihm auch noch ein Wirtshaus zugestanden. Aus dieser Urkunde und andern gleichzeitigen Besiedelungsurkunden läßt sich klar entnehmen, daß um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Mähren und im Herzogtum Troppau die Robot bereits allgemein eingeführt war und bei Neubestiftungen wesentlich ungünstigere Bedingungen sowohl für die Lokatoren als auch für die Ansiedler selbst festgesetzt wurden. Die Folge davon war, daß
nur noch wenige Deutsche aus dem Reiche Lust verspürten, sich in den Ländern der böhmischen Krone, also auch im Gesenke, niederzulassen und tatsächlich zeigt die sehr geringe Zahl von Urkunden über Neugründung von Dörfern, daß die deutsche Dorfkolonisation in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im Wesentlichen ihren Abschluß gefunden hatte. Da die Lasten der Ansiedler durch Einführung der Robot sowie Erhöhung der anfangs mäßigen Zinsungen und anderen Abgaben immer größer wurden, so kam es vor, daß Ansiedler freiwillig ihren emphyteutischen Besitz verließen und sich anderwärts, mit Vorliebe in den königlichen Städten, ansiedelten. Die Grundherren erachteteten dadurch ihre Interessen als geschädigt, da ein Ersatz für die Ausgewanderten schwer zu finden war, insbesondere nach dem Jahre 1348, wo der schwarze Tod durch Europa ging und nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande viele Bewohner dahinraffte. Der Adel, stets auf sein Interesse sehr bedacht, suchte auch diesmal Maßnahmen auf Kosten der Rechte des Volkes zu treffen, die ihn vor weiteren Schädigungen schützen sollten. Solange Karl III . regierte, wagte man es nicht, offen mit seinen Forderungen aufzutreten. Als dieser aber 1378 gestorben war und das schwache Regiment seines Sohnes Wenzel folgte, benutzten die habsüchtigen Barone die Zerwürfnisse im Königshause, um ihre geplanten Absichten zu erreichen. Es wurde der „Mährische Herrenbund“ gegründet, der sich mit dem ebenso habsüchtigen Markgrafen Jost gegen den König verband. Am 26. Juli 1380, es war gerade in der Zeit, da die Bauern im Schweiße ihres Angesichtes die Ernte ihrer Gutsherren unter Dach brachten, versammelten sich die letzteren im Einverständnis mit dem Markgrafen auf dem Spielberge in Brünn und unterzeichneten hier einen Vertrag, durch welchen die Freizügigkeit, der Bürger und Bauern eine wesentliche Einschränkung erfuhr. Es wurde nämlich bestimmt, keinen fremden Untertanen mehr auf ihr Gut aufzunehmen ohne Vorweisung eines Entlassungsbriefes von der Herrschaft, der er bisher angehörte. Ohne einen solchen sei er dem früheren Grundherrn zurückzuschicken. Mit dieser Verfügung war der erste Schritt zur Einführung der Leibeigenschaft getan; denn der deutsche Ansiedler, dem bei der Begründung neuer Orte volle Freizügigkeit gewährleistet war, ist von nun an persönlich an die Gutsherrschaft resp. an den Gutsherrn gebunden. Diese Bestimmungen hatten auch für das Herzogtum Jägerndorf Geltung, da damals in unserem Herzogtum die Angelegenheiten des Adels und deren Untertanen noch nach Mährischem Rechte behandelt wurden; auch sei noch bemerkt, daß gerade in jener Zeit der Markgraf Jost von Mähren, mit dessen Zustimmung ja die Beschlüsse auf dem Spielberge gefaßt wurden, durch 21 Jahre (1390-1411) den Herzogshut von Jägerndorf trug. Auch später noch kommen neue Frohnden auf oder die bestehenden werden verschärft. Wo immer sich ein Anlaß bot, an den bestehen
den Verhältnissen etwas zu ändern, da geschieht es stets zum Nachteil der Bauern und zum Vorteil der Gutsherren. Geradezu verhängnisvoll für das Volk wurde die schwache Regierung
des Königs Wladislaw V. 1471-1516. Der Herren- und der Ritterstand wußten die Freigebigkeit des Königs wohl auszunützen und so kam es, daß nur zu bald fast sämtliche Krongüter sich in den Händen der Adeligen befanden, denen der König machtlos gegenüber stand. Diese Machtlosigkeit gab dem Adel die erwünschte Gelegenheit, seine Rechte auf Kosten der untertänigen Städte und Dörfer zu erweitern und sie herrschten in drückender Weise über Bürgertum und Bauernschaft. Besonders als Wladislaw 1490 König von Ungarn geworden war und seinen Sitz nach Ofen verlegt hatte, konnten die Herren vom Adel und die Prälaten das Landvolk bis zur völligen Leibeigenschaft herabdrücken, den Städten verschiedene Rechte, wie jenes der Bierbrauerei oder das des Ankaufes von Landgütern nehmen und die königliche Gewalt bis zum Schatten herabwürdigen. Ja, sie gingen in ihrer Ungebundenheit sogar so weit, daß den Vertretern der königlichen Städte, dem sogenannten dritten Stande im Landtage die Stimme entzogen wurde; nur bei städtischen Angelegenheiten sollten sie gehört werden. Diese Errungenschaften wußte der Feudaladel sich durch die im Jahre 1500 beschlossene sogenannte Wladislaw'sche Landesordnung zu sichern. Damals übte jeder Stand sein oermeintliches Recht mit der ihm zur Verfügung stehenden Gewalt aus, so daß die alten Staatseinrichtungen immer mehr verfielen und ungebundene Willkürherrschaft der Mächtigen über die Schwachen hereinzubrechen drohte. Der Mangel einer starken ausübenden Gewalt, welche die Vollziehung der Gesetze überwachte, zeigte sich insbesondere in der immer größeren Anhäufung von Lasten und in immer größerer Einschränkung der persönlichen Freiheit, die der Adel ganz unberechtigt dem Bauernstande auflud, so daß um das Jahr 1500 n. Chr. in den Ländern der böhmischen Krone auch die anfangs freien deutschen Ansiedler gleich den slawischen Hörigen von dem hochfahrenden, anmaßenden weltlichen wie geistlichen Feudaladel zu Leibeigenen herabgedrückt worden waren. Die allgemeine Verstimmung der unterdrückten, aus einer günstigen Position mehr und mehr herausgetriebenen Bauern ist seit dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts in wiederholten aufständischen Bewegungen zutage getreten, aber etwas
erreicht haben die Bauern durch diese Aufstände fast in keinem Falle, sondern ihre Lage dadurch oft noch verschlimmert. Einer der widerwärtigsten Kämpfe fand 1514 unter dem bereits erwähnten schwachen Könige Wladislaw V. in Ungarn statt. Der unerträgliche Druck, der auf dem untertänigen Volke lastete, erzeugte einen wilden Bauernaufstand mit Verübung von entsetzlichen Grausamkeiten an den Adeligen, die dann ihrerseits auf noch grausamere Weise an den Bauern Rache nahmen: Georg Dozca, der Haupträdelsführer des Aufruhres, wurde auf Züpolyas, des Wojwoden von Siebenbürgen Befehl auf einen glühenden, eisernen Thron gesetzt und mit einer glühenden Krone auf dem Haupte und einem glühenden Zepter in der Hand lebendig gebraten. Eine Anzahl seiner Gefährten aber, die man eine zeitlang hatte hungern lassen, wurden zum Verzehren des Fleisches gezwungen. Auf welch tiefem ethischen Standpunkte der damalige ungarische Adel stand, zeigt sich darin, daß dieser Johann Züpolya (Johann Zápolya) seitdem der Liebling des ungarischen Adels und der Hauptwidersacher des Königs war, nach dessen Throne selbst sein Trachten ging.
Auch die Dorfbewohner in unseren Bezirken waren mit der Zeit leibeigene Bauern geworden und der hierländische Lehensadel und dessen Beamte verstanden es ebenso wie anderwärts, das Los ihrer Untertanen immer trauriger und unerträglicher zu gestalten. Eine Besserung dieser Zustände trat erst unter Maria Theresia ein; denn mit dem Patent vom 3. Februar 1770 wurde es den Leibeigenen wenigstens gestattet, gegen eine vom Leibherrn versagte Heiratsbewilligung oder wider die verweigerte Loslassung, oder selbst gegen das zu hochgestellte Loslassungsgeld eine Beschwerde bei der landesfürstlichen Behörde zu überreichen. Schon diese Kaiserin hatte den bäuerlichen Zuständen große Aufmerksamkeit zugewendet, aus unfreien Leibeigenen den Stand erblicher Nutzeigentümer geschaffen, das übliche Maß der Schuldigkeiten untersuchen und feststellen lassen, ein Maximum des drückendsten Dienstes der Robot bestimmt und in den Kreisämtern den Untertanen unparteische Richter bestellt. Mehr als eine bloße Erleichterung ihrer Dienstbarkeit konnten die Bauern von Maria Theresia nicht erwarten, da dieselbe den Frondienst als ein alterworbenes Recht der Grundobrigkeit betrachtete. Als Beispiel, welches Maß von-Fronden zur Zeit der Regierung Maria Theresias in unserem Bezirke zu leisten war, diene Braunsdorf, wo für die Bauernschaft nach dem Fürst Liechtenstein'schen Urbarium vom 28. August 1770 jährlich 548 dreispännige Robottage, für jeden Häusler 24 Handrobottage, wovon aber wöchentlich nicht über 4 Tage verlangt werden durften und für die Inleute 13 Robottage festgesetzt waren. In außerordentlichen Fällen konnten sie aber zu einer Mehrleistung gezwungen werden.
Überdies hatten die Ganzbauern (die Hübner) 8, die Halbhübner 4 und die Viertelhübner 2 Breslauer Scheffel sogenannten Jagdhafer zu liefern und außerdem mußte jeder Hübner 2 fl. 80 kr. rheinisch an Georgi- und Michaelizins, 2 fl. 39 kr. rheinisch Gisenhammer-Robotgeld, 12 kr. rheinisch Rinderzins, 54 kr. rheinisch Hühnerzins und 8 kr. rheinisch Gierzins entrichten. Diesen Leistungen entsprechen im Verhältnisse auch die der andern Bauern; nur der Erbrichter, die Pfarrei, die Schule, die zwei Freihöfer und die Mühle waren von der Robot befreit. Dagegen hatten diese, Pfarrei und Schule ausgeschlossen, das Laudemium an das fürstliche Rentamt zu zahlen.
Unter Laudemium versteht man das Lehngeld, die Lehngebühr, welche der Obereigentümer, der Lehnherr, in diesem Falle der Fürst Liechtenstein für die Annahme eines neuen Nutzeigentümers von diesem erhält. Diese Abgabe wurde nicht selten zu einer drückenden Last, indem bei Veräußerungen von robotfreien, bäuerlichen Grundstücken, manchmal selbst bei Vererbung oder wenn der Lehnherr wechselte, eine bestimmte Summe an den Grundherrn gezahlt werden mußte. Das Laudemium für Braunsdorf betrug XXX des Wertes des gekauften oder geerbten Grundstückes.
Ein großer Förderer des Bauernstandes war Kaiser Josef ll. Er war kein reund der Feudalverfassung und setzte die Reformen zu Ungunsten der bestehenden Grundherrlichkeit fort. Nach den ökonomischen Anschauungen des Kaisers, die er mit hervorragenden Zeitgenossen teilte, bildete der Grund und Boden die wichtigste Quelle des Volksreichtums; die Produktionskraft ruht aber nicht in den geschlossenen Güterkomplexen, sondern, wie bereits Sonnenfels mit besonderem Nachdrucke betont, in der Kleinwirtschaft. Es gilt demnach, insbesondere den Stand der Bauern zu heben, ,,die Emsigkeit auf dem Lande von
dem auf ihr lastenden Drucke zu befreien, die Stütze des Staates und des Nationalreichtums auch als solche zu krästigen.« Daß mit diesen Absichten die unfreie Stellung des Bauers, namentlich in den slawischen Provinzen, in argem Widerspruch stand, derselbe auch als Persönlichkeit höher geachtet werden mußte, sollte er die ihm und seinem Besitze im Staate zugewiesene Rolle dauernd durchführen, hatte Josef ll. gleich in den ersten Jahren seiner Regierung erkannt und demgemäß eine Reihe von Gesetzen erlassen, welche sich wie Glieder einer Kette aneinanderfügten und die von dem Kaiser beabsichtigte soziale Reform wirksam vorbereiteten. Schon im ersten Regierungsjahre (1. September 1781) erschien das für die böhmischen Provinzen höchst wichtige Untertanspatent, das auch für die Bauern des Gesenkes Geltung hatte. Durch dasselbe wurden die Verhältnisse zwischen den Untertanen und ihren Herrschaften genau bestimmt und die ersteren gegen etwaigen Druck und gegen
Willkür der letzteren dadurch in Schutz genommen, daß ihnen das Recht der Beschwerdeführung eingeräumt war. In Fällen, wo die Untertanen eine Forderung an die Herrschaft zu stellen hatten, sollten sie sich zuerst an diese wenden und eine schriftliche Antwort abwarten. Erfolge diese binnen einer gewissen Frist nicht, so hatten sich die Bauern an das Kreisamt zu wenden und bei diesem Hilfe zu suchen. Dasselbe Ziel wie das Untertanspatent verfolgte das gleichzeitig erschienene Straspatent. Auch dieses untergrub die frühere Stellung des Adels. Es beschränkte das Strafrecht der Herrschaftsbesitzer in Bezug auf die Feudalverpslichtungen der Untertanen. Geldstrafen wurden durch dasselbe verboten, größere Strafen an weitläufige Förmlichkeiten von Protokollaufnahmen und an die Genehmigung der Kreisämter gebunden und somit die Zwangsmittel, durch welche die Herrschaften das Feudalverhältnis aufrecht erhielten, ihnen fast ganz aus den Händen gewunden. Eine weitere Maßregel Kaiser Josess zur Auflösung des Feudalsystems war die Aufhebung der Leibeigenschaft, wo sie noch wie bei uns bestand. In Böhmen wurde sie am 15. Januar 1782, bald darauf in Mähren mit Schlesien, Krain, Galizien, Lodomerien, Vorderösterreich und am 11. August 1785 auch in Ungarn aufgehoben. Über die Grundsätze, welche den Kaiser dabei leiteten, sprach sich Josef ll. in den Patenten selbst aus, wo es heißt: „Da wir in Erwägung gezogen haben, daß die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Einführung einer gemäßigten Untertänigkeit nach dem Beispiele unserer österreichischen Erbländer (Österreich ob und unter der Enns, Steiermark, Kärnten) auf die Verbesserung der Landeskultur und Industrie den nützlichsten Einfluß habe, auch daß Vernunft und Menschenliebe für diese Änderung das Wort sprechen, so haben wir uns veranlaßt gefunden, von nun an alle Leibeigenschaft auch in unseren slawischen Ländern ganz aufzuheben und statt derselben eine gemäßigte Untertänigkeit einzuführen.
Die wesentlichsten Vorteile, die mit der Aufhebung der Leibeigenschaft verbunden waren, bestanden darin, daß es den früheren Leibeigenen nunmehr freistand, sich zu verehelichen, von der Herrschaft wegzuziehen und nach freier Wahl Handwerke und Künste zu erlernen und dort ihrem Nahrungserwerbe nachzugehen, wo sie ihn fanden, ohne daß die Herrschaft, wie früher, Hindernisse in den Weg legen konnte. Ferner wurde Grund und Boden gegen angemessenes Entgelt Eigentum des Bauern, so daß dieser seine ihm eingeräumten Gründe nach Gutdünken benützen, versetzen, verpfänden, verkaufen oder vertauschen konnte; nur durften die zu den Häusern gehörigen Gründe nicht von diesen getrennt werden.
Die Freude über das kaiserliche Geschenk war bei jenem Teile der Bevölkerung, dem es zugute kam, eine außerordentliche. Das Volk strömte frohlockend zu den Altären und feierte drei Tage lang unter Opfer- und Dankgebet die Wohltat. In Galizien machte die Verkündigung des Patents den sonderbarsten Eindruck auf die Bauern. Sie vernahmen anfangs jedes Wort mit Staunen und brachen endlich in lautes Frohlocken, viele in -Tränen aus. Das Patent kam ihnen wie eine Erscheinung aus einer andern Welt vor; freilich waren die leibeigenen Bauern kaum irgendwo von den Edelleuten und noch mehr von deren Beamten so sehr tyrannisiert und dem Viehe gleich behandelt worden als gerade in Galizien.
Der Feudaladel sowohl weltlichen wie geistlichen Standes aber war mit den Josefinischen Einführungen und Neuerungen durchaus unzufrieden und bemühte sich vereint, gegen den Willen des Kaisers die alten Untertänigkeitsverhältnisse wieder herzustellen. Um seinen Zweck zu erreichen, verdächtigte er beim Volke die Neueinführungen Kaiser Josefs, insbesondere auch die religiösen Neuerungen und suchte den Glauben zu erwecken, Kaiser Josef bezwecke mit seinen Einrichtungen nichts anderes, als dem Volke seine liebgewordenen, altgewohnten Sitten und Gebräuche zu nehmen und es seiner Religion abwendig zu machen. Das niedere Volk war diesen Einflüsterungen deshalb leicht zugänglich, weil ja die Reformen Josefs tatsächlich auf die Sitte und Gewohnheit, auf das Überlieferte und historisch Gewordene keine Rücksicht nahmen. Die mit Absicht gestreute Saat ging daher nur zu bald auf und man meldete allenthalben von Empörungen und Unruhen in den Provinzen, welche die Josefinischen Neuerungen hervorgerufen haben. Der Kaiser, durch Kriegsunfälle entmutigt, durch die Undankbarkeit des Volkes verbittert und von allen Ratgebern verlassen, stand der Empörung in den einzelnen Provinzen hilflos gegenüber. Um das Volk zu beruhigen, erklärte er in der berühmten Resolution vom 28. Januar 1790 offen und aufrichtig Folgendes: „Ich habe Veränderungen in der Verwaltung vorgenommen bloß in der Absicht, durch dieselben das allgemeine Wohl zu fördern und in der Hoffnung, daß das Volk nach näherer Prüfung sich mit denselben befreunden werde. Nun ich aber die Überzeugung gewonnen, daß das Volk die alten Zustände vorziehe, seine ganze Glückseligkeit in denselben suche und finde, so gebe ich seinen Wünschen nach und erkläre die Verwaltungsformen, wie ich sie bei meinem Regierungsantritte vorfand, wieder zu Recht bestehend.“
Nur zwei Patente, das Toleranzedikt und jenes über die Abschaffung der Leibeigenschaft, nahm er nicht zurück und damit hat sich Josef ll. Den Dank aller wahrhaften Menschenfreunde für alle Zukunft gesichert. Kaiser Josef kränkelte damals schon und starb in dem schmerzlichen Bewußtsein, seine zehnjährige Tätigkeit als Herrscher mit einem Federzuge ausgestrichen zu haben, am 20. Februar 1790.
Wenige Wochen nach dem Tode des Kaisers war bereits in allen Provinzen sein von ihm durchgeführtes Regierungssystem in ein lockeres, unzusammenhängendes Stückwerk verwandelt und viele Hände bemühten sich, das Gerüst, auf welches das alte Österreich sich gestützt, wieder auszurichten. Die rührigste Tätigkeit entwickelten natürlich die Provinzialstände, die geistlichen und weltlichen Feudalherren. Zehn lange Jahre zur völligen Machtlosigkeit verurteilt, suchten sie jetzt durch verdoppelten Eifer das Versäumte nachzuholen und durch feste Begründung ihres Ansehens und ihres Einflusses der Wiederkehr Josefinischer Zeiten vorzubeugen.
Alle Landtage hatten sich unmittelbar nach Kaiser Josefs Tode versammelt. Der Ton der hier geführten Verhandlungen verriet deutlich den lange unterdrückten Grimm und Haß gegen das Josefinische Regierungssystem. Nicht ein Wort der Trauer fiel über den Tod des Kaisers, sondern alle hatten in Eile beinahe gleichlautende Wünsche an den Kaiser Leopold ü. gerichtet und zwar:
Wiederherstellung der alten ständischen Vorrechte, Rücknahme der Steuergesetze. und der den Bauern gewährten Befreiungen, Aufhebung aller die Juden und Freigeister, die Protestanten und Ausländer begünstigenden Maßregeln, Wiederbelebung der kirchlichen Macht u.s.w. lauteten im Wesentlichen die Forderungen, die man wie anderwärts auch auf dem Landtage in Troppau stellte. Die Regierung, welche bemüht war zu beschwichtigen und zu versöhnen, gab in allen Punkten nach, welche das Herkommen und die Sitte für sich hatten und der Eitelkeit der Stände schmeichelten. Zäher und beharrlicher aber zeigte sie sich, wenn es galt, Forderungen zu bewilligen, die geeignet find, die Macht der Regierung zu schmälern wie z. B. in der Frage der Aufhebung des Josefinischen Untertanenpatentes vom Jahre 1781. Die Regierung hatte ins dieser Angelegenheit freilich keine völlig freie Hand. Düstere Gerüchte von dem drohenden Rücksalle in die alte Knechtschaft hatten das Ohr der mißtrauischen Bauern getroffen und dieselben zu eindringlichen Demonstrationen veranlaßt. Bauernabordnungen kamen nach Wien und brachten ihre Klagen und Bitten beim Kaiser persönlich vor. Auf dem flachen Lande gingen die Bauern noch weiter und suchten mit Gewalt ihr vermeintliches Recht zu wahren. Den einen antwortete man mit beruhigenden Versprechungen, den anderen mit militärischer Exekution. Allgemein war man voller Erwartung, zu wessen Gunsten die Frage des Untertänigkeitsverhältnisses entschieden werden wird. Auch in unserem Bezirke (Jägerndorf), wo ein Fall vorkam, der die Bauernschaft sehr beunruhigte. Im Anfang des Jahres 1790 hatten sich nämlich in Braunsdorf 20 Familien zur Auswanderung nach Galizien gemeldet und zeigten dies durch den Erbschulzen beim Kammerburggrafenamte in Jägerndorf an. Der Fürst Liechtenstein'sche Kammerburggraf aber verweigerte kurzweg die Übersiedlung und dokumentierte damit, daß er das Josefinische Patent, welches den Untertanen die Freizügigkeit gewährleistete, als nicht mehr zu Rechte bestehend betrachte. Die Landstände nämlich lebten in der zuversichtlichen Hoffnung, daß die Regierung ihnen eine grundsätzliche Anerkennung ihrer früheren Rechte über die Untertanen wieder einräumen, ja sogar eine ausgedehnte Erweiterung ihrer Macht und Wirksamkeit gewähren werde. Diese Erwartungen jedoch gingen nicht in Erfüllung; denn in der königl. Resolution vom 21. Mai 1790, in der die Beschwerden.der schlesischen Stände ihre Erledigung fanden, wurden die Forderungen: die Bauern und Handwerksgesellen sollten sich nicht frei verheiraten dürfen, sollten bei der Entlassung aus dem Untertansverbande ein Lösegeld entrichten, die Kreisämter sich nicht weiter zu Beschützern der Bauern aufwerfen, rundweg abgeschlagen. Noch viel weniger zeigte sich die Regierung geneigt, die in ihren Händen gesammelte Vollmacht über alle Bewohner des Reiches abermals teilen zu lassen und den Ständen wie ehedem die Provinzialverwaltung anzuvertrauen oder ihnen einen maßgebenden Einfluß bei
der Gesetzgebung einzuräumen. Die Stände mußten sich vielmehr mit nur einzelnen Zugeständnissen begnügen, die, an sich karg zugemessen, von ihrem Werte noch dadurch verloren, daß der König nur aus Gnade gewährte, was als Recht gefordert worden war. Selbst die Zurücknahme des Josefinischen Grundsteuergesetzes durften die Stände nicht als glänzenden Sieg feiern, da die Regierung dasselbe angeblich nur aus formellen Gründen, weil bei der Ausmessung und Abschätzung des Bodenertrages Unrichtigkeiten vorgekommen waren, aufhob und das Recht der Wiedereinführung sich vorbehielt. Die Stände setzten zwar ihre Opposition in den Landtagen fort; allein diese flaute allmählich ab, als die Regierung durch kluges Beschwichtigen, teilweises Nachgeben und halbe Gewährungen dem ständischen Widerstande die Spitze abgebrochen hatte.
Da überdies die Landstände zu der Überzeugung gelangten, daß sie ihren Willen gegen den der Regierung nicht werden durchzusetzen vermögen, begnügten sie sich mit der Belassung der Robot (Fronden und Zinsen) und der Beibehaltung der Gerichtsbarkeit über die Untertanen (Patrimonial-Gerichtsbarkeit), jedoch hatten die Untertanen das Beschwerderecht an die Kreisämter. Letztere aber besaßen nicht immer den Mut und den Willen, den Bauer in ausgiebiger Weise gegen die Übergriffe eines angesehenen Edelmannes oder seiner Beamten zu schützen, insbesondere seit der Zeit, als den Kreisämtern die Weisung zukam, die Obrigkeiten nicht zu belästigen, sie vor den Untertanen nicht mutwillig herabzusetzen und sich nicht so sehr als Richter, sondern als freundliche Vermittler anzusehen. Trotz alledem aber muß im allgemeinen der Wahrheit gemäß konstatiert werden, daß das Los des Landmannes ein weitaus günstigeres geworden war im Vergleich zu dem seiner Vorfahren zur Zeit der Leibeigenschaft. Nach dem Voranstehenden könnte man annehmen, daß der Bauer nun mit seinem Geschicke zufrieden war. Dem aber war nicht so. Die Ideen der Neuzeit, in Hinsicht der Gleichheit aller Staatsbürger bezüglich ihrer Rechte und Pflichten drangen auch allmählich in die Kreise der Landbevölkerung und belehrten diese, daß das Untertänigkeitsverhältnis ihres Standes, des zahlreichsten im Staate, im grellsten Widerspruche damit stand. Diese Erkenntnis machte dem Bauer sein Los weit unerträglicher, als die Leibeigenschaft seinen Vorfahren gewesen ist. Da auch der Aufschwung der Industrie und der Landwirtschaft selbst Volkswirtschaftliche Lehrmeinungen über das Wesen und die Natur der Arbeit in Umlauf brachte, mit welchen die Untertänigkeit nicht in Einklang gebracht werden konnte, so bedurfte es, wie Biermann in seiner Geschichte der Herzogtümer Troppau und Jägerndorf sagte, nur eines Anstoßes, um sie „mit allen ihren Robotverpflichtungen, ihren lästigen und veralteten Zinsungen und mit der Patrimonialgerichtsbarkeit zu Fall zu bringen.“
Und diesen Anstoß gab ein Bauernsohn unseres Bezirkes, der 26-jährige Jüngling Hans Kudlich im Jahre 1848, im ersten konstitutionellen Reichsrate in Wien. Hans Kudlich war der Sohn eines gut situierten Bauers aus Lobenstein und wurde hier 1823 geboren. Er besuchte das Gymnasium in Troppau, worauf er nach Wien ging, um sich der juridischen Laufbahn zu widmen. Als hier im Jahre 1848 die Revolution ausbrach, schloß er sich derselben an und kämpfte als akademischer Legionär am 13. März für die Freiheit vor dem Landhause, wobei er einen nicht ungefährlichen Bajonettstich durch die Hand erhielt. Kurz darauf von seinen schlesischen Landsleuten zu ihrem Abgeordneten in den Reichsrat gewählt, stellte er als solcher schon in der dritten Sitzung (26. Juli) nach feurig beredten Worten den Antrag, die hohe Versammlung wolle beschließen: „Von nun an ist das Untertänigkeitsverhältnis samt allen daraus entsprungenen Rechten und Pflichten aufgehoben, vorbehaltlich der Bestimmungen, ob und wie eine Entschädigung zu leisten sei.“ Mit der begeisterten Annahme dieses Antrages und den darüber nachher in bedeutender Ernüchterung gefaßten Beschlüssen, ward die Befreiung des Bauernstandes in Österreich vollendet und der Name
Hans Kudlich ein unsterblicher. Der Gedanke des Antrages war allerdings kein neuer und hätte, wie Schuselka bemerkte, viel praktischer gefaßt und sachgemäßer begründet und verteidigt werden können; dies aber vermindert nicht die Wichtigkeit des Faktums, daß ein Bauernsohn, das jüngste Mitglied der Versammlung, mit jugendlichem Feuereifer für das Recht. seiner Standesgenossen auftrat und die Versammlung so zu begeistern verstand, daß sie den Antrag sofort in Beratung nahm und ihn wenigstens dem Prinzipe nach zu einem definitiv günstigen Resultate führte.
Von ständischer Seite hat man den Antrag Kudlichs vielfach als einen unüberlegten und voreiligen getadelt; man sagte, er habe der Regierung und dem Reichsrate vorgegriffen, denn es verstehe sich ja von selbst, daß die Untertänigkeit in einem konstitutionellen Staate nicht weiter bestehen könne. Allein dieses Urteil ist entschieden falsch und ungerecht. Man hatte gut sagen, die Aufhebung der Untertänigkeit verstünde sich in einem konstitutionellen Staate von selbst. Sie verstand sich auch in dem früheren patriarchalischen Staate, als dessen Grundlage mit so viel Salbung und frömmelnder Gleißnerei die Gerechtigkeit geltend gemacht wurde, von selbst, und doch blieben die Bauern untertänig zum Hohn auf Recht und Religion, zum Nachteil der Staatswirtschaft und lediglich, um den Säckel der Aristokraten und Prälaten zu füllen und deren vornehme Herrschaftspassionen zu befriedigen. Seit Jahren salbaderte man auf allen ständischen Landtagen über die Aufhebung der Untertänigkeit, zehnmal wurde dieselbe auch von der Regierung als eine Notwendigkeit und als allerhöchsters Wille auf dem Papier proklamiert; aber man kam damit doch nicht weiter, als daß man dem Bauer erlaubte, sich wie ein Sklave um schweres Geld loszukaufen, falls die gnädige, gestrenge Herrschaft darein willigte. Und viele Herrschaften versagten dem Untertan die Loskaufung und zwar häufig nicht des materiellen Vorteiles wegen, sondern weil es sie kitzelte, eben Herrschaften zu sein und Untertanen zu haben. Im März proklamierte man die konstitutionelle, im Mai sogar die demokratische Monarchie, aber der eigentliche Demos,(das Volk) die Bauern, blieben Untertanen der Aristokraten, Hierarchen und Wucherer. Hätten die Bauern warten müssen, bis ihnen durch die Konstitution die Freiheit zuerkannt und zugemessen worden wäre, so hätte dies soviel geheißen, als die Freiheit sei für die Bauern kein natürliches, ewiges Recht, sondern ein Geschenk der sogenannten höheren und besseren Stände. Kudlich ergänzte also mit seinem Antrag nur die Revolution des März und Mai, er holte gleichsam das nach, was die damaligen Wortführer und Antragsteller vergessen hatten. Wie aufrichtig übrigens die privilegierten Stände es mit dem Bauernstande meinten, zeigte sich in der Behandlung des Kudlich'schen Antrages selbst. Fürs erste ließ man eine große Spanne Zeit vorübergehen, bis man zur Vollberatung schritt und eine noch größere, bis sich aus seiner Bandwurm Debatte endlich der Beschluß losrang. Ja, es bildete sich unter dem Einflusse der Stände eine Partei, es war dies das bureaukratische, doktrinäre Schreibfedertum des Reichsrates, welche große Bedenken gegen den Kudlich'schen Antrag erhob, einzig nur deshalb, um die Debatte über diesen Antrag so lang als möglich hinauszuschieben.
Andere wieder, es war kein geringes Häuflein Abgeordneter, wollten sogar den Antrag von der Tagesordnung des Reichstages absetzen und die Austragung dieser Angelegenheit den Provinziallandtagen überlassen. Kudlich, dem um das Schicksal seines Antrages bangte, zog seinen ursprünglichen, zu allgemein gehaltenen Antrag zurück und brachte einen detaillierteren Verbesserungsantrag ein, den er in der Sitzung vom 8. August mit einer hinreißenden, begeisternden Rede begründete. Allein die Detaillierung der Untertänigkeitsfrage verschaffte der Pedanterie und Rabulisterei einen weiten Spielraum, den man einträchtiglich in unausstehlicher Breitmäuligkeit ausnützte und zunächst die Wirkung hervorbrachte, daß eine Flut von Verbesserungsanträgen in den folgenden Sitzungen eingebracht und mit großem Wortschwalle begründet wurden. Endlich am 17. August war die Reihe der Verbesserungsanträge mit dem 73. erschöpft, damit aber der Schluß der Verhandlungen noch lange nicht erreicht. Im Gegenteil sollte erst jetzt die eigentliche Debatte, die Rede für und gegen den Kudlich'schen Antrag beginnen. Die meisten Redner aber sprachen weder für noch gegen den Antrag, sondern über denselben und zwar vielfach so langweilig und verworren, daß sich der Saal immer bedenklicher leerte und am 20. August eine derartige Anzahl von Abgeordneten sich der bandwurmartigen Debatte entzog, daß sich der Präsident zur Schließung der Sitzung veranlaßt fand. Erst als die Entschädigungsfrage zur Verhandlung gelangte, kam wieder frisches Leben in die Versammlung; denn diese allein bot nur noch ein praktisches Interesse, weckte die Leidenschaften und erregte die Geister.
Die Unklarheit, Zweideutigkeit und Heuchelei so vieler Redner machte anfangs die Debatte schleppend und gehaltlos; sie erwärmte sich aber in den Fällen, wo mit Entschiedenheit und derber Offenherzigkeit, sei es für oder gegen die Entschädigung gekämpft wurde. Vornehmlich waren es die bäuerlichen Abgeordneten, deutsche wie slawische, welche durch die beredte Darlegung ihrer adelsfeindlichen Gesinnung allgemeines Aussehen erregten und den Konservativen Entsetzen einflößten. Bereits bei der Ankündigung der Verbesserungsanträge hatten sich einzelne in diesem Sinne vernehmen lassen. „Wer gab dem Gutsherrn das Recht, den Untertan zu knechten, und wie kann jener jetzt die Ablösung der Bauernlasten fordern ? Der Bauer ist noch gut, aber eine aufgedrungene Ablösung wird er nicht dulden“. Diesem Mahnrufe eines oberösterreichischen Landwirtes folgte die stärkere Drohung eines Kärntner Bauern: ,,O diese unbarmherzigen Gutsbesitzer, welche dem Bauer die letzten Tropfen Blutes ausgesogen haben und nun noch eine Entschädigung verlangen! Eine namentliche Abstimmung verlange ich, damit man auch weiß, wer diese Unterdrückers noch in Zukunft unterstützen will und der Untertan es erfahre, wer ihm noch ferner eine ungerechte Steuer abpressen will“.
Dieser Ton wurde auch in der eigentlichen Debatte von den Bauernabgeordneten beibehalten: „Keiner Behörde, keiner Regierung möchte ich raten, eine Robotsteuer einzuführen, wenn sie nicht gestürzt sein will. Mögen diejenigen, die sich in ihren Rechten
verkürzt glauben, an die hohen Ahnengeister appellieren; Millionen können Einzelner wegen nicht leiden. Der Bauer kann keine Entschädigung leisten, denn die Kaste, welcher wir die Entschädigung zusprechen würden, ist uns nicht freundlich gesinnt. Das ist aber ein schlechter Feldherr, welcher dem Feinde die Waffen und die Munition in die Hände liefert. Die Köpfe jener, welche für die Entschädigung stimmen, sind nicht mehr wert, als was die anatomischen Anstalten für sie bezahlen“ (Mediziner Dr. Anton Bittner, Abgeordneter von Hohenstadt in Mähren.) Ein anderer Abgeordneter wieder nannte die hohen Adeligen im Gegensatze zu den absoluten Fürsten von Gottes Gnaden, die Herrn von Kanaille's Gnaden! öfters erlaubte sich die Gegenpartei zu den Ausfällen der Bauern in ein Gelächter auszubrechen. Aber niemand lachte, ein schwerer Ernst vielmehr lagerte auf der Versammlung, als der galizische Bauer aus Solotwina namens Iwan Kapuszak, schwerfällig, in gebrochenem Deutsch, aber den fanatischen Haß gegen den Edelmann in jeder Gesichtsmuskel ausgeprägt, mit geballter Faust und rollendem Auge seine Meinung über die Robotfrage kund gab. „Ja, der Edelmann hat den Bauern liebevoll behandelt. Wenn er ihn auch die Woche über arbeiten ließ, so bewirtete er ihn doch am Sonntage er ließ dem Bauer Ketten anlegen unds sperrte ihn in den Kuhstall, damit er in der nächsten Woche noch fleißiger arbeite. Ja, der Edelmann ist human, denn er muntert den ermüdeten Robotbauer mit Peitschenhieben auf und beklagt sich einer, er hätte zu schwaches Zugvieh und könne die verlangte Arbeit nicht leisten, so wird ihm zugerufen: „Spanne dich und dein Weib ein! Ja, die Grundherren haben uns Bauern die Robot geschenkt. Aber wann? Etwa im Jahre 1836 oder im Januar dieses Jahres, oder am 8., 9. März? Nein, erst am 17. April, nachdem die Söhne des deutschen Volkes für unsere Rechte ihr Leben als Opfer dargeboten haben. Dreihundert Schritte vor dem Palaste des Edelmannes mußten wir schon die Mütze demütig abziehen und wollten wir etwas b ei dem Gutsherrn durchsetzen, so mußten wir den Juden bestechen; denn der Jude hatte das Recht mit dem Herrn zu sprechen, der arme Bauer aber nicht. Wollte der arme Bauer die Stiege des Palastes hinaufsteigen, so hieß es, er solle nur im Hofe bleiben, er stinke, und der Herr könne seine Ausdünstung nicht leiden. Und für diese Mißhandlungen sollten wir jetzt noch eine Entschädigung leisten? Ich sage: Nein! Die Peitschen und Knuten, die sich um unsere Köpfe, um unsere ermüdeten Körper gewickelt haben, damit sollen sich die Herrn begnügen, das soll ihre Entschädigung sein.“
Diese im Zorn und wilden Grimme gehaltene Rede reizte die Verteidiger der Entschädigung zu ähnlicher Leidenschaft und drohte dadurch den Reichstag zum Schauplatze gewalttätiger Handlungen zu machen. Alexander Freiherr von Helfert, ein böhmischer Abgeordneter beschuldigte die Bauern direkt der Diebsgelüste und bemerkte: „Die Aufhebung der untertänigen Lasten ohne Entschädigung ist eine neue Auflage von der Legende des heiligen Krispin, von dem erzählt wird, daß er den reichen Leuten das Leder stahl, um daraus den Armen Schuhe zu machen. Das Leder sind hier die obrigkeitlichen Forderungen; dieses Leder beabsichtigt man, den Gutsherrn zu stehlen, um den Bauern daraus Schuhe zu verfertigen.“ Da derselbe Abgeordnete zufolge seiner häufig spöttischen Äußerungen über die Bauern bei diesen ohnehin schon verhaßt war, so entstand über die kecklich ausgesprochenen Worte Helferts ein förmlicher Aufruhr; mit geballten Fäusten stürzte man auf den Redner los, so daß dieser nur mit Mühe Mißhandlungen entging. Wiederholt schellte die Glocke des Präsidenten nach Ruhe, der von Kudlich aufgefordert wurde, den Redner zur Ordnung zu rufen; dieser aber hielt sich dazu nicht befugt, da er keine persönlichen Angriffe in den Worten des Redners zu finden vermochte. Helferts Rede jedoch hinterließ einen nachhaltigen Eindruck bei jenen Abgeordneten, die für die Entschädigung zu stimmen gesonnen waren und verband sie um so inniger zu dem Zwecke, die Aufhebung der Robot aus den Taschen des Volkes bezahlen zu lassen.
Kudlich, der in allen Sitzungen stets zugunsten der Bauern intervenierte erhielt am 26. August als Antragsteller das Schlußwort, das die Zaghaften und Unentschlossenen wieder aufrichtete und bei der Abstimmung eine Mehrheit für den Kudlich'schen Antrag auf Nichtentschädigung erhoffen ließ. Die Sache aber kam ganz anders. Nach Kudlich ergriff gegen allen parlamentarischen Brauch noch Minister Bach im Namen des Ministeriums das Wort und sagte: „Über zwei große Prinzipienfragen wird die Entscheidung des Reichstages ausgerufen. Es gilt die Aufhebung des persönlichen Untertänigkeitsverbandes und der Entlastung des Grundes und des Bodens. Für die Aufhebung des Untertansverbandes, für die Aufhebung der obrigkeitlichen Gewalt und Gerichtsbarkeit wird Niemand den Grundherrn auch nur einen Heller bewilligen. Was dagegen die dingliche Belastung des Bodens betrifft, so ist die Entschädigung dafür nach der einstimmigen Ansicht des Ministeriums eine Frage des Rechtes und der politischen Klugheit.Das Kabinett wird mit der Entschädigungsfrage stehen oder fallen.“ Das Ministerium trat mit dieser Erklärung entschieden auf Seite der Gutsherrn und hatte einen abermaligen Umschwung in der Majorität, diesmal zugunsten der Entschädigung, zur Folge; denn die Furcht vor einem Kabinettwechsel machte viele zu Überläufern in das Lager der Entschädigungssüchtigen; selbst bäuerliche Abgeordnete befanden sich darunter, die mit der Schreckensmäre, daß als Folge der Ministerabdankung die Sprengung des Reichstages und eine abermalige, jedoch bauernfeindliche Revolution eintreten würde, in die listig gestellte Falle gingen. Kudlich selbst verlangte noch einmal das Wort, um eine Abstimmung unter dem unmittelbaren Eindrücke der ministeriellen Erklärung zu verhindern und ihre Wirkung zu schwächen. Das formale Recht sprach für ihn; aber der Präsident Strohbach, regierungsfreundlich gesinnt, wies das Begehren Kudlichs nach längerem, scharfem Streite ab. Wütend über den Terrorismus des Ministeriums legte die Kudlichpartei einen Protest ein, der aber nur zur Folge hatte, daß die Abstimmung nicht unmittelbar erfolgte, sondern auf die nächste, nach mehrfach geäußertem Wunsche erst am 29. August stattfindende Sitzung verschoben wurde.
Am 29. August lag auf dem Pulte jedes Abgeordneten ein stattliches Folioheft, welches in 20 Artikeln 159 Fragen enthielt, welche das Abstimmungsmateriale umfaßte. Diese mühevolle Arbeit Strobachs war aber gleichfalls zwecklos. Nach langen Zwischenreden, wobei Kudlich stets den Versuch wagte, auf Bachs Rede eingehend zu antworten, aber stets unterbrochen und von den Gegnern niedergeschrieen wurde, beschließt endlich die Versammlung, Strobachs Fragensystem als ein unentwirrbares Labyrinth fallen zu lassen, dagegen die einzelnen Antragsteller zu einem Kompromiß aufzufordern. Bringen diese einen Kollektivantrag zustande, so soll ihm die Priorität bei der Abstimmung gebühren. Die Besprechungen begannen sofort nach aufgehobener Sitzung und dauerten bis in die tiefe Nacht. Wie zu erwarten war, blieb auch dieser Schritt ohne Erfolg; denn Kudlich hatte kein Interesse an einer Verständigung, welche sich wesentlich auf seine Nachgiebigkeit gründete. Man einigte sich zwar in den Punkten, welche die Aufhebung der Untertänigkeit betrafen, aber in der Entschädigungsfrage nicht, sodaß in der am Tage darauf (30. August) folgenden
Sitzung zwei Kollektivanträge vorgelegt wurden: jener des Abgeordneten Lasser, der den konservativen Standpunkt und der des Kudlich, welcher den demokratischen Standpunkt vertrat. Welcher von diesen Anträgen sollte zuerst in Verhandlung genommen werden? Nach stundenlangem Streite wurde endlich beschlossen, am nächsten Tage, d. i. am 31.August, zuerst über Lassers dann über Kudlichs Kollektivantrag gleich nach Eröffnung der Sitzung ohne eine weitere Debatte zu gestatten, abstimmen zu lassen. Am 31. August begann endlich die Abstimmung und es schien anfänglich, als ob das gestern beschlossene Programm einer raschen Erledigung werde zugeführt werden; denn die drei ersten Punkte des Lasserschen Antrages, die sich mit denen Kudlichs deckten, als: Aufhebung der Untertänigkeit, Entlastung des Bodens, Aufhören aller aus dem Untertänigkeitsverhältnisse entspringenden und ihm anklebenden Lasten, Dienstleistungen und Giebigkeiten wurden einstimmig und unter schallendem Jubel angenommen. Die Bauern verließen die Bänke und drückten den Abgeordneten, die sie erreichen konnten, herzlich die Hand. Noch war aber die Hauptschlacht nicht geschlagen, über die Entschädigung nichts entschieden.
Als der Präsident sich anschickte, den vierten und fünften Absatz des Lasser'schen Antrages zu verlesen, welche von der Entschädigung handelten, verwandelte sich die Einmütigkeit in bittern Streit und die friedliche Ordnung in wilden Aufruhr. Die Bauern und die Linke wollten von einer weiteren Abstimmung nichts hören. Der oberösterreichische Abgeordnete Franz Peitler erhob sich zuerst und rief: „Wenn man die Abstimmung darüber zugäbe, so sei für die Bauern die Hauptschlacht verloren!“ Abgeordneter Umlauft drohte nicht undeutlich mit der Volksrache und sagte: „Wir Bauernvertreter können über die Entschädigungssrage nicht früher urteilen, als bis wir eine genaue und detaillierte Grundlage vor uns haben. Wir enthalten uns aller Abstimmung, protestieren gegen das weitere Verfahren und werden unseren Kommittenten gleich mitteilen, daß heute der Beschluß der gänzlichen Aufhebung der Gutsuntertänigkeit und aller Lasten gefaßt worden ist!“ Sprachs und verließ mit mehreren Demokraten und Bauern trotzig den Saal. Umlauft hatte gehofft, es werden seinem Beispiele eine solche Anzahl folgen, daß seine Absicht, den Reichstag beschlußunfähig zu machen, erreicht werde. Allein da dies nicht der Fall war, kehrte er mit seinem Anhange wieder in den Saal zurück. Daselbst aber hub, da sich niemand an den Beschluß des verflossenen Tages kehrte, sich jeder weiteren Debatte zu enthalten, der leidenschaftlichste Streit zu entbrennen an, ob die Entschädigungsfrage blos im Prinzip oder in ihren Einzelheiten entschieden werden solle. Beide Parteien überboten sich in Protesten, Anklagen, schlauen Ränken und kopflosen Schwänken. Abgeordnete, welche vermittelnd eintreten wollten, wie der grundehrliche Schuselka, steigerten nur mit neuerlichen Verbesserungsanträgen die Verwirrung. Alles drohte aus Rand und Band zu gehen. Daß es nicht dazu kam, verhütete bloß die Nachgiebigkeit Lassers, der seinen Antrag wesentlich modifizierte und die Energie des Präsidenten, der, als von Seite der Linken ein Antrag gestellt wurde, welcher einen kaum gefaßten Beschluß rückgängig zu machen bezweckte, derartig ergrimmte, daß er kurzweg erklärte: „Einer Versammlung, welche einen gestern gefaßten, heute umgestoßenen, dann wieder bestätigten Beschluß abermals brechen will, mag ich nicht länger vorsitzen.“Mit diesen Worten verließ er den Präsidentenstuhl und erklärte sein Amt für erledigt. Erst dieses Gewaltmittel veranlaßte die Linke, ihren Antrag fallen zu lassen.
Strobach wurde mit Akklamation wieder zum Präsidenten gewählt und endlich zur Abstimmung über den Kardinalpunkt: „Billige Entschädigung für alle Leistungen und Abgaben, welche der Grundbesitzer als solcher dem Gutsherrn schuldet“ geschritten. Er wurde mit 174 gegen 144 Stimmen angenommen. 36 meist demokratische Abgeordnete enthielten sich der Abstimmung und bekundeten damit aufs neue den Mangel an Parteidisziplin. Auch die folgenden, weniger wichtigen Punkte fanden nach kurzem Geplänkel ihre Annahme. Nur noch ein einziger Punkt erschien wichtig genug, um abermals durch namentliche Abstimmung entschieden zu werden. Dieser war: Soll der Entschädigungsfond für jede Provinz besonders gebildet, aus Mitteln der Provinz zusammengebracht und nur in der letzteren verwendet werden oder ist derselbe in einer Reichskasse zu vereinigen? Mit 224 gegen 125 Stimmen wurde die Bildung unabhängiger Provinzialfonds beschlossen und damit, wie die Wiener Zeitungen klagten, die Grundlage zu einer Föderativverfassung gelegt.
Nach Lassers Antrag gelangte der Verabredung gemäß jener Kudlichs zur Abstimmung, obgleich dieser durch die Annahme des ersteren größtenteils schon erledigt war, was auch Kudlich ausdrücklich betonte und darauf hinwies, nachdem nun eine Entschädigung geleistet werden soll, sei als Ergänzung noch die Bestimmung von Wichtigkeit, daß für die nicht auf Privatverträgen beruhenden Lasten die Entschädigung vom Staate zu leisten wäre. Bei der darauf folgenden Abstimmung widersprach sich die Majorität selbst, indem sie mit einer Mehrheit von 48 Stimmen die Entschädigung durch den Staat beschloß, was sie einige Minuten früher abgelehnt hatte. Über diese Blamage herrschte ebenso grenzenloser Jubel bei den Anhängern Kudlichs wie Ärger auf Seite der Gegner. Letztere benutzten die nächste Gelegenheit, um den Fehler wieder gut zu machen, was ihnen auch gelang, indem sie Kudlichs Antrag als Ganzes bei der Abstimmung mit 152 gegen 148 Stimmen zu falle brachten. Dieses Endergebnis rührte vornehmlich davon her, daß die slawischen Bauern durch das Hin- und Hergezerre zwischen den Parteien so wirbelig geworden waren, daß sie nicht mehr recht wußten, wofür sie eigentlich stimmten. Nun herrschte aus der Rechten und im Zentrum großer Jubel, bei den Mitgliedern der Linken dagegen leidenschaftliche Entrüstung. Diese klagten das Reichstagsbureau einer absichtlichen Fälschung bei der Stimmenzählung an und drangen zuletzt aus nochmalige Zählung des Hauses. Um dies zu verhüten, machten die Mitglieder der Rechten durch Verlassen des Sitzungssaales die Versammlung beschlußunfähig und ließen die Linke im bitteren Gefühle ihrer Niederlage zurück.
In den darauffolgenden vier Septembersitzungen wurden die noch übrigen Verbesserungsanträge zur Abstimmung gebracht, wobei sich der tiefe Zwiespalt der Parteien in nicht minder würdeloser Weise entblößte. Die parlamentarische Schlacht über die Untertänigkeit hatte hiermit ausgerast und keiner der Parteien einen vollständigen Sieg gebracht. Die demokratische Partei war zwar in der Entschädigungsfrage unterlegen,-immerhin aber durfte sie den 26. Juli, den 8. und 31. August zu den Ruhmestagen ihrer Kämpfe zählen, sie hatte als Bannerschaft Hans Kudlichs in die Zwingburg des österreichischen Feudalstaates eine unausfüllbare Bresche geschossen, sie hatte die Entjochung der Bauernschaft vom Mittelalter für die Unvergänglichkeit ersiegt!
Am 7. September erhielt das neue Gesetz die Sanktion Kaiser Ferdinand l., wozu der Historiker Anton Springer in seiner ,,Geschichte Österreichs seit dem Wiener Frieden« Band ll bemerkt:
„Erst seit dem 7. Sepember 1848 ist Österreich in Wahrheit in die Reihe der modern organisierten Staaten eingetreten, hat mit dem Mittelalter gründlich und für immer gebrochen und der Reaktion eine unübersteigliche Schranke gesetzt; denn der grundbesitzende Adel (weltlichen wie geistlichen Standes), der Träger der Reaktion war nicht imstande, in diesem Punkte das alte Österreich wieder in das Leben zurückzurufen“.
Hinsichtlich der Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit wird in dem sanktionierten Gesetze vom 7. September 1848 in Punkt 9 folgendes bestimmt: ,,Die Patrimonialsbehörden haben die Gerichtsbarkeit und die politische Amtsverwaltung provisorisch bis zur Einführung landessürstlicher Behörden auf Kosten des Staates fortzuführen.“ Die Übergabe vollzog sich im Jahre 1850. Am 1. Jänner die politische Verwaltung, am 1. Juli die Gerichtsangelegenheiten.
Schließlich sei hier noch erwähnt, daß auf Anregung des Wiener Blattes „Der Freimütige“ am 24. September die niederösterreichischen Bauern Hans Kudlich in Wien einen Dankfackelzug mit Nachtmusik brachten, bei welcher Gelegenheit er mit großer Begeisterung als Bauernbefreier gefeiert wurde. Um einigermaßen Einsicht in die Gerichtsbarkeit der Patrimonialzeit zu gewinnen, sei erwähnt, daß diese in früheren Jahrhunderten in unserem Landes in eine höhere und niedere zerfiel. Die erstere wurde vom Jägerndorfer Landrechte ausgeübt, in dem die angesehensten Adeligen des Landes saßen und Recht sprachen. (Die Dominien Geppersdorf, Gotschdorf und Olbersdorf gehörten zum Landrechte Troppau.)
Den Vorsitz führte der Herzog, der sich durch den Landeshauptmann vertreten ließ. Diese Behörde war sowohl eine Justiz-, Administrativ- wie Realbehörde bis zur Regierungszeit der Kaiserin Maria Theresia, welche die Verwaltung von der Justiz trennte. Beim Landrechte konnte wohl auch der leibeigene Bauer seinen Herrn anklagen; allein diese Beschwerden blieben in der Regel ohne Erfolg, da die Beisitzer Bekannte und Verwandte des Angeklagten waren. Von viel größerer Bedeutung war für die Untertanen die niedere Gerichtsbarkeit, welche von den Dominien und Magistraten ausgeübt wurde. Solche gab es im Umfange unseres Schulbezirkes in Branitz, Bransdorf, Geppersdorf, Gotschdorf, Jägerndorf (Kammer), Jägerndorf (Magistrat), undd Olbersdorf. Die Dominien zählten 1845 an Untertanen: Branitz 16, Bransdorf 2173, Geppersdorf 1627, Gotschdorf 7701, Jägerndorf 19.865, Olbersdorf 6939 und die Stadt Jägerndorf 8684 Einwohner.
Um die Gerichtsbarkeit leichter ausüben zu können, wurde in den untertänigen Dörfern im Laufe eines Jahres je ein sogenannter Dingtag, später auch Termin genannt, von dem Gutsverwalter resp. Kammerburggrafen in Jägerndorf der Justiziär und dessen. Amtsschreiber unter Zuziehung des Ortsrichters, der Ältesten und Geschworenen abgehalten, bei dem alle Grundkäufe abgeschlossen, die hiefür entfallenden Zahlungen, Raten, Zinsungen festgesetzt und schließlich vom Amtsschreiber in das sogenannte Waisenbuch (Weisungsbuch?) eingetragen wurden. Dieses Buch, welches in damaliger Zeit das heutige Grundbuch ersetzte und seit den Hohenzollerschen Fürsten 1523 in deutscher Sprache geführt wurde, ist in der Gemeindelade aufbewahrt worden und galt zugleich als Quittierungsbuch. In der Gemeindelade wurden beim Waisenbuche auch, da die Dorfbewohner nur selten lesen und schreiben konnten, die Kerbhölzer aufbewahrt. Wie aus dem Aubelner Waisenbuche von 1550 zu ersehen ist, wurde jedem, der einen Besitz übernahm, ein Kerbholz, d. i. ein Stabholz, in welches so viele Kerbe gemacht wurden, als der Besitzer in Talern schuldig war, eingelegt. Bei jedem Dingtag schnitt man ihm so viele Kerbe ab, als er Schulden abzahlte. War er mit der Tilgung seiner Schulden fertig, so erhielt er ein grünes Reis ausgefolgt, welches er aus seinem Haustore aufstecken konnte, zum Zeichen, daß er schuldenfrei war oder, wie man damals sagte, daß er nichts mehr aus dem Kerbholze hatte. Bei den Dingtagen wurden auch Streitigkeiten und Klagen unter den Untertanen beigelegt und ausgetragen, so daß die Wirksamkeit derselben sich teilweise auf die Funktionen der heutigen Gemeindeämter und jene der Bezirksgerichte erstreckte.
Die wichtigste Person im Dorfe war der Erbrichter (Scholze), welcher den Altesten und Geschworenen vorstand. Gr hatte vor den andern Anfassen eine bevorrechtete Stellung und ward schon bei der Anlegung oder Besiedlung des Dorfes als Lokator mit einem größeren, robotfreien Grundbesitze ausgestattet. Der Erbrichter war das Vollzugsorgan der Obrigkeit und hatte dieselbe als ein des Ortes und der Leute kundiger Mann zu unterstützen. Als solcher mußte er die Ableistung der Robot überwachen, die Zinsen einkassieren und Sorge tragen, daß der Zehent ordentlich entrichtet werde. Außerdem hatte er noch viele andere Obliegenheiten zu besorgen, von denen die Heerespflicht ihm die meistens Verlegenheiten bereitete; denn der Kriegsdienst wurde von unsern Vorfahren sehr gescheut und man versuchte, sich demselben durch Verstecken oder Flucht während der Assentzeit zu entziehen. Diese Scheu ist in vieler Hinsicht begreiflich, wenn wir bedenken, daß der Assentierte so viel als verloren war und derselbe zufolge der langen Dienstzeit (14 Jahre) und der vielen Kriege seine Heimat erst spät, oft auch gar nicht mehr wiedersah.
Für die vielen Pflichten und Sorgen, welche mit dem Amte des Erbrichters verbunden waren, hatte er außer den schon früher erwähnten Rechten und Gerechtigkeiten noch die Benützung eines Ackers, des sogenannten Richterstückes zu Recht. War der Erbrichter nicht fähig das Ortsrichteramt auszuüben, oder wollte er dasselbe nicht übernehmen, so wählte die Gemeinde ihren Richter, dem man den Titel ,,Betrichter« beilegte. Dieser wurde für die Zeit seiner Amtswirksamkeit von der Robot befreit und erhielt auch die Benützung des Richterstückes.
Weitere lesenswerte Artikel:
 Das Troppauer Inquisitionsprotokoll.
Das Troppauer Inquisitionsprotokoll.
 Berühmte Persönlichkeiten aus Schlesien, wichtige Schlesier
Berühmte Persönlichkeiten aus Schlesien, wichtige Schlesier
 Fußnoten
Fußnoten